



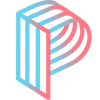


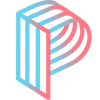

Picknick am Wegesrand
Ausstellungstext Edelbert Köb über Alexander Groiss
Ausstellungstext Lucia Klee-Beck über David Eisl
Am 2. Freitag im April
Der Ausstellungstitel Am 2. Freitag im April erinnert unmittelbar an die Date Paintings von On Kawara. Die Datumsangaben ermöglichten ihm, im konzeptionellen Sinne sein Leben mittels Zeit- und Ortangaben in die Kunst zu transformieren, da dem Bild auch der jeweilige Zeitungsausschnitt beigelegt ist. Kawara selbst war öffentlichkeitsscheu und verstand es, seine Persönlichkeitsangaben in der Schnittmenge zwischen Ort, Geschehen und Dauer zu beschreiben. Ein Umstand, der dem Titel Hofers ebenfalls innewohnt. War es doch der ursprünglich geplante Eröffnungstermin der hier zu besuchenden Ausstellung, der vom Künstler als mündliche Eselsbrücke so weitergegeben wurde und plötzlich durch eine bisher noch nie dagewesene Epidemie einen neuen Kontext erhielt. Es war eben nicht der abwesende Künstler, der die Datums- und Ortsangabe zum Porträt seiner künstlerischen Praxis wählte, sondern der Umstand eines globalen Zusammenhangs – der bis heute noch anhält – und über Nacht notwendig gewordene Maßnahmen einleitete, die jeden betrafen und noch immer betreffen.
Es ist immer vermessen, ein scheinbar vom künstlerischen Prozess unabhängig stattfindendes Ereignis automatisch in die Arbeit zu inkludieren und sich eines trittbrettfahrenden Fortbewegungsmechanismus zu bedienen. Aber die in diesem Bild angegebene Struktur der Mobilität und Bewegung entspricht den intuitiven Stadtraumerfahrungen eines Kartographens wie Siggi Hofer. Er reduziert subtil in seinen Zeichnungen Raum und Zeiterfahrungen, die Orientierungssysteme als Sprache verdichten. Jene Akribie: Punkt für Punkt, Aussage für Aussage, Handlung für Handlung grafisch festzuhalten ist zentraler Motor der künstlerischen Auffassung von Siggi Hofer.
Umso mehr lässt sich der notwendig gewordene Maßnahmenkatalog als Kondition und Schablone unseres Zusammenlebens im und außerhalb des Kunstbetriebes lesen. Das Raster wird zur Taktfrequenz unseres Bewegungsspielraums und zur noch nie dagewesenen Selbsterfahrung. Die parallelen Handlungsmotive zwischen Kunstpraxis und Gegenwart verdichten sich und ergänzen das Narrativ der Ausstellung. Ungeplant wird das Motiv der grün-weiß-roten Rose zum Solidaritätsmotiv für Italien und den aktuellen Geschehnissen.
Das Motiv der Rose ist nicht nur in seinem romantischen und politischen Spektrum ikonografisch aufgeladen, sondern auch eine Kindheitserinnerung des Künstlers aus seiner Schulzeit in Italien. So gab es Schreibhefte, so Hofer, die am unteren Rand den einzelnen Kästchen folgend Motive zum Nachzeichnen und Üben offenließen. Wenn wir wieder zurückblicken, auf Maßnahmen, Handlung und Effekt, die auf die Akribie des Künstlers schließen, verstehen wir die Selbstverständlichkeit der Haltung Hofers, die Handlung und das Motiv in den künstlerischen Prozess eingreifen zu lassen. Unterstützt wird dies durch die auf mehreren Holzplatten verteilten Schriftsätze, wie come on sister, come on brother oder ich will kein Mensch sein, die zu den Rosen entsprechend gleich einem rezitierten Text zu Aufführung kommen. Die Textsplitter werden zu mobilen, an die Wand gelehnten Protagonisten, die sich zu den Rosen wie auf einer Bühne bewegen und unsere Gedanken als Selbsterfahrung des zuletzt Erlebten spiegeln. Wir können die Aussagen nicht nur direkt für uns vom Skript lesen und zu eigen machen, sondern sie auch durch den Raum tragen, neu justieren und kombinieren. Wenn Kunstproduktion zentral unsere Eigenschaft zur Identifikation und Distanz aufgreift, ist dies auf den tragbaren Sperrholzplatten im oben beschriebenen Zeitfenster des Epidemie bedingten Lockdowns am direktesten und unmittelbarsten umgesetzt. Und fast hätten wir es vergessen, dass sich On Kawara immer noch im Raum befindet, ohne je dagewesen zu sein, da auch unsere Gegenwart auf Verschriftlichungen beruht, die von außen gegeben, getragen und gelesen werden.
Um so mehr lassen sich der notwendig gewordeneMaßnahmenkatalog als Kondition und Schablone unseres Zusammenlebens im und außerhalb des Kunstbetriebes lesen. Das Raster wird zur Taktfrequenz unseres Bewegungsspielraums und zur noch nie dagewesenen Selbsterfahrung. Die parallelen Handlungsmotive zwischen Kunstpraxis und Gegenwart verdichten sich und ergänzen das Narrativ der Ausstellung. Ungeplant wird das Motiv der grün-weiß-roten Rose zum Solidaritätsmotiv für Italien und den aktuellen Geschehnissen.
Karin Pernegger
In der Ausstellung ist die Rose in 7 Variationen mit Lack auf 110 cm x 120 cm Mdf Patten gemalt zu sehen und steht im Zentrum der Ausstellung
Linda Reif & Andreas Waldén
Jeder Tag dieser Woche vereint alle Jahreszeiten in sich. Das ist seltsam. Nicht so seltsam wie die Wüste, eher wie das Innere eines Flugzeuges. Es ist so heiß, dass die Hände vom Schweiss kleben, dann so kalt, dass die Handgelenke schmerzen. Der Wind ist scharf, bitter und riecht alt. Die Sonne späht gerade hinter ihrem Schatten hervor, während ich dies schreibe. Der Arm eines Kranes fährt an meinem Fenster vorbei. Es sieht aus als würde er die Wolken über den Himmel schieben. Der Winter macht keinen Sinn mehr.
Linda stellt “big dick paintings” mit Hilfe der Sonne her. Sie wartet bis sie erscheinen, nachdem sie mit Chemikalien bearbeitet wurden. Jede Oberfläche ist ein Neuanfang und eine Ende. Jedes Bild unterstützt die Dokumentation der Sonnenbahn. Manche sind Zitate der gestischen Malerei der “harten Jungs” im Nachkriegs-New York. Manche sind schmal und seltsam geformt. Zusammengestellt werden sie zu Persönlichkeiten, jede ihrer Gesten erzählerisch. Kapitel bewegen sich langsam und hartnäckig vorwärts. Ihre Gallenblase wurde erst vor kurzem entfernt. Sie experimentiert viel in der Dunkelkammer, braucht jedoch keine Kamera mehr. Ich verstehe den Belichtungsprozess nicht wirklich. Sie meint, es sei schwer diesen vorherzusagen.
Andreas verwendet Linien, um die Zeitlichkeit des Trägermaterials zu markieren. Farbe kommt und geht, überbrückt Zwischenraum und bringt den zeitlichen Ablauf durcheinander. Jede Oberfläche ist ein Neuanfang und eine Ende. Sie sind ansprechend in ihrem Auftreten und erzählen ihre eigenen Geschichten. Manche sehen aus wie Geschwister. Manche tun das nicht. Seine Linien sind flach und bilden Grüppchen, die zu Gebieten werden. Sie schweben über der Oberfläche und zittern. Bisweilen verdichten sie den Raum, dann wiederum trennen sie ihn und wecken Neugier auf perspektivische Tiefe. Er sieht mit kurzem Haar viel jünger aus. Manche seiner Arbeiten öffnen sich zur sie umgebenden Architektur hin, andere sind stur und selbstbezogen. Ich möchte gerne glauben, dass es in seinen Arbeiten um die Freude am Finden und Verlieren von Raum geht.
Linda und Andreas arbeiten im selben Raum. Sie teilen Bett, Küche und Bad miteinander. Sie sehen gemeinsam fern und sprechen eine Sprache, die nicht ihre Muttersprache ist, um miteinander zu kommunizieren. Sie übernehmen Formen und Gedanken über Materialität, Oberflächen und Markierungen voneinander und spielen sie wieder zurück. Die Wände in dieser Ausstellung zeigen die bearbeiteten Aufzeichnungen ihrer Gespräche. Diese sind nicht chronologisch, aber bilden die Zeit ab.
Seth Weiner
Wien, Februar 2020
Übersetzung: Claudia Slanar
RECONFIGURATIONS
Die Arbeiten von Sophie Dvořák lösen geografische Landstriche und Areale aus ihrer kartografischen Verfasstheit und fokussieren einstige landvermesserische Darstellungen als farbliche Versatzstücke, die neu konfiguriert werden. Minutiös sezierte Elemente werden in Collagen zu neuen Konstellationen zusammengefügt, deren geflechtartige Strukturen als Matrix verfremdeter Visualisierungsmodelle dienen und an Variablen einer virtuellen Welt erinnern. Dvořák hinterfragt die Existenz von kartografischen Darstellungsmodi als „Master Narrative“ einer geglaubten Weltvermessung sowie die inhärenten subjektiven Perspektivitätsmomente, die einem konstanten, historisch und technisch bedingten Wandel unterworfen sind.
In Anlehnung an Fredric Jameson’s postmodernes und postindustrielles Subjekt, das durch einen ständigen Ortswechsel einen Verlust traditioneller Kartografien erfährt, beschäftigt sich Dvořák mit jenem Erfahrungshorizont, der das einstige Lesen von geografischen Karten obsolet erscheinen lässt und translokale Erfahrungen in den Vordergrund der Debatte rückt, die zu einem neuen Mapping von Terrains führen, das nicht nur geografisch, sondern vor allem kognitiv angelegt ist. „Under Construction – Atlas van Europa en de Werelddelen”, eine Arbeit aus 2016, nimmt einen niederländischen Atlas „von Europa und den Kontinenten“ aus dem Jahr 1967 als Ausgangspunkt, um unterschiedliche Farbflächen daraus zu extrapolieren und diese in das Format der Collage zu übertragen. Die rhizomatische Anordnung der einzelnen Flächen und Gebiete lässt nach wie vor Grenzen erkennen, die jedoch aufgelöst ins Nichts zu driften scheinen. Ähnlich der Polarkreise, wo sämtliche Spuren zu verwischen drohen, thematisiert Dvořák Momente einer geopolitischen Realitätsverschiebung. Auf historischer Ebene handelt es sich bei diesem Atlas um eine Weltsicht aus der Zeit des Kalten Krieges, die längst als überholt geglaubt gilt. Was bleibt ist eine kognitive Vorstellungskraft, die zweidimensionale Kartografien nicht länger einzulösen vermögen. Diese wurden spätestens seit Modulen wie Google Earth um eine Dimension erweitert, wodurch der Übergang zwischen realen und digitalen Bildwelten zunehmend problematisiert erscheint.
Sophie Dvořák nimmt sich jener Problematik einer kartografischen Bildsymbolik an und erweitert diese künstlerisch im Ausstellungsraum. In „Reconfigurations“ verhandelt sie vor allem grafische Elemente und Farbgebungen, wie sie einst in Atlanten zu finden waren. Dem niederländischen Atlas ist ein Raum mit Collagen, einem Holzobjekt und zwei Gipsplatten gewidmet. Die gelbe Anordnung verweist auf selbige Flächen im Atlas, die weiter abstrahiert und aus ihrer Zweidimensionalität entnommen werden, da die Ansichten letztendlich auf dreidimensionale Strukturen rekurrieren. Im zweiten Raum wird ein bildlicher Ausschnitt aus dem europäischen Grenzterritorium Richtung Osten vergrößert an die Wand affichiert und zwei Collagen darüber montiert. Der Verweis auf geologische Schichten wird hier offensichtlich, andererseits versucht die Künstlerin skizzenhaftig einzugreifen, um den Kartencharakter zu reduzieren und schließlich in Flächen und Farben aufzulösen. An der gegenüberliegenden Wand befindet sich eine Rasterstruktur, die einem Kartenmesser entnommen wurde, der zum Bestimmen und Eintragen von Koordinaten mit Winkel und Neigungen dient. Dazu gefügt werden grafische Darstellungen, die mathematische und geometrische Methoden der Kartenprojektion aufgreifen. Dvořák changiert hier zwischen Faktizität und Visualität, die als künstlerisch verhandelte Tropen in den Bildraum übertragen werden. Damit führt ihre Arbeit zu einer Kontemplation von Momenten einer Wirklichkeitsdebatte, die stets einer visuellen Definitionsmacht unterliegt. Statistische und systematische Messfehler müssen hier ebenso berücksichtigt werden wie deren visuelle Interpretation in einer künstlerisch-diskursiven Welt.
Walter Seidl
Bei uns
Spuren der Diskriminierung im urbanen Raum
Hana Usuis Semiotik der Ausgrenzung
„Eine kunstlose Wahrheit über ein Übel, über eine Gemeinheit, ist ein Übel, eine Gemeinheit. Sie muss durch sich selbst wertvoll sein: dann gleicht sie das Übel aus, versöhnt mit der Kränkung, die der Angegriffene erleidet, und mit dem Schmerz darüber, dass es Übel gibt.“ Karl Kraus
Mit „Bei uns“, ihrer ersten Einzelausstellung bei WOP – Works on Paper setzt Hana Usui (geb. 1974, Tokio) die Arbeit zu politischen und sozialkritischen Themen fort, mit der sie 2014 begonnen hat. In den Werken die seitdem entstehen, knüpft sie an ihre langjährige Praxis abstrakter Zeichnung an, sucht aber immer neue Wege und Formen um schwierige Themen, die sie persönlich bewegen, zu reflektieren. Dabei agiert Usui nicht frontal oder bloß dokumentarisch, sondern schafft chiffrierte und kunstvolle Werke, die ihre künstlerische Praxis medial zur Skulptur oder Fotografie hin erweitern.
Die Atombombenabwürfe auf Hiroshima und Nagasaki, die Tragödie in Fukushima, die Todesstrafe – und jetzt in der Ausstellung „Bei uns“ auch die alltägliche Diskriminierung – sind keine einfachen Themen. Dennoch schafft es Usui durch ihre persönliche Herangehensweise, uns einen neuen Blick auf sie zu eröffnen. Indem sie vom konkreten Phänomen abstrahiert, gibt sie uns den Raum, den wir brauchen, um uns selbst mit den Themen auseinanderzusetzen.
Diese Subtilität findet sich bereits mit „Bei uns“, dem Titel der Ausstellung, mit der Usui eine Sprachfigur aufgreift, die oft unbedacht verwendet wird. Wenn man zu jemandem sagt „Bei uns…“ und womöglich anschließt mit „macht man das aber anders“, vermittelt man der angesprochenen Person einerseits, dass man sich nicht der gleichen Gruppe zugehörig fühlt wie sie und zweitens, dass man davon ausgeht, dass sie nicht weiß, wie man sich „bei uns“ korrekt verhält. Die Möglichkeit, dass der oder die Sanktionierte bewusst abweichend gehandelt hat, wird negiert. Wie durch den Titel der Ausstellung das scheinbar unschuldige und jedenfalls unscheinbare „bei uns“ in den Brennpunkt kommt, nehmen auch die Werke scheinbar banale Alltagsphänomene in den Fokus. Dabei entwickelt Usui eine Art persönliche Semiotik (also Zeichenlehre) – und vielleicht sogar eine Ästhetik – der Diskriminierung.
Ausgangspunkt der meisten Werke ist eine Spurensuche im urbanen Raum in Usuis Herkunftsland. In jedem der ausgestellten Werke arbeitet sie mit einer Fotografie und einer Ölpause auf semitransparentem Papier. Für die großformatigen Arbeiten wurden zwei Ensembles ein weiteres Mal fotografiert, so dass die zwei Blättern fotografisch fusionieren. Indem die Künstlerin jeweils assoziativ zeichnend und fast spielerisch auf das Thema der desaturierten und entschärften Lichtbilder reagiert, schafft sie Arbeiten, deren Hintergründigkeit nicht nur allegorisch ist. Zunächst erblicken wir rätselhafte Symbole oder Malspuren, die über urbane Szenen aus Asien schweben. Die Fotografien sind auf den ersten Blick vor allem durch ihre Merkmalslosigkeit bemerkenswert. Tatsächlich greift aber jedes Bild eine ganz bestimmte Situation auf, in der Integrationsschwierigkeiten deutlich werden.
Weil sie oft keine Jobs bekommen und von der japanischen Sozialkasse ausgeschlossen werden, bleibt für Koreaner in Japan oft nur der Ausweg einer ungewollten Selbstständigkeit: Sie eröffnen Snackbars, Gemischtwarenläden, Sexshops, Spielhöllen oder werden Taxifahrer*innen. Jede von Usuis Fotografien zeigt Spuren dieser staatlich und gesellschaftlich verhinderter Integration. Gerade, dass es nicht laute Szenen sind, die gleich auf den ersten Blick einen Aufschrei auslösen, macht die Bilder wertvoll. Denn ein Großteil der Diskriminierungen ist nicht laut und sichtbar, sondern so unterschwellig und uneindeutig, dass selbst die, die ihr zum Opfer fallen, oft unsicher sind, ob sie gerade wegen ihrer Herkunft, sexuellen Präferenz oder aus anderen Gründen Ablehnung und Kälte erfahren.
Usui reagiert auf jedes Foto individuell, indem sie einen Aspekt der fotografischen Darstellung aufgreift. Die Fotos von Taxis überlagern Malspuren, die einer Straße ähneln; aus koreanischen und japanischen Schriftzeichen entwickelt sie eine Art abstrakten und unlesbaren Zeichenregen; ein koreanischer Essensverkauf wird mit Essstäbchen oder einem Grillnetz in Verbindung gebracht; die Sexindustrie reflektiert sie mit Formen die Gucklöchern ähneln; runde Formen evozieren das Glücksspiel Pachinko, bei dem Automaten mit kleinen Kügelchen gefüttert werden.
Die Werke sollen auch unseren Blick schärfen für Anzeichen von Diskriminierung in unserem eigenen Umfeld. Dass Usui dabei allerdings nicht pedantisch, didaktisch oder direkt anprangernd verfährt, entspricht einem Ideal, das Karl Kraus explizit zum Grundprinzip seiner Gestaltungsästhetik gemacht hat, wenn er in seiner künstlerischen Auseinandersetzung mit Missständen stets versuchte, Texte zu schaffen, die nicht nur die Übel anprangern, sondern durch ihre Form gefallen. Die Entscheidung sich den Übeln kunstvoll zu nähern, ist also nicht nur eine ästhetische, sondern auch eine ethische.
Hana Usui wird 1974 in Tokio geboren und studiert schon als Kind bei bekannten japanischen Meistern Kalligraphie. 1999 löst sie sich gänzlich vom Schriftzeichen und arbeitet nur noch auf Bilduntergründen mit Tusche, sonst mit Ölfarbe. Für die Ölpausen bei „von uns“ verwendet sie eine Technik, die sie selbst entwickelt hat, die es ihr erlaubt, mit einem Schraubenzieher zu zeichnen durch festes Aufdrücken des Papiers auf eine mit Ölfarbe bestrichene Fläche, Formen zu schaffen. Usuis Arbeiten sind Teil wichtiger internationaler Sammlungen wie der der Albertina, des Museums der Moderne in Salzburg oder der Staatlichen Museen zu Berlin .
Dr. Klaus Speidel
No Man Is Big Enough for My Arms
Curated by Goschka Gawlik
Karolina Jablonska – eine der bekanntesten jungen Vertreterinnen der neuen Malerei in Polen – schloss vor drei Jahren ihre Diplomarbeit an der Akademie der Schönen Künste in Krakau ab und seit dem entwickelt sie dynamisch Schritt für Schritt ihre künstlerische Karriere. Sie arbeitet sowohl individuell als auch in kollaborativer Praxis. Sie ist keine „Ausnahmefrau“ in einem Krakauer Künstler-Trio, das gleichzeitig eine Galerie, einen Verlag sowie das gemeinsame Kuratieren von Ausstellungen betreibt und sich einen Erfolg heraufbeschwörend Potencja (Potenz) nennt. Die seit 2012 agierende Potencja hat mit ihren performativen Aktivitäten und dunklen, Bild-starken Formaten längst auch die heimische Kunstszene erobert.
In der Wiener Galerie Works on Paper zeigt die bravouröse Malerin ihre Arbeiten auf Papier, die sie parallel zu ihrer Malerei schafft. Sowohl in ihrer Malkunst als auch in den Papierarbeiten bleibt die menschliche Figur dominant und ein einprägsamer Stil – ein Oszillieren zwischen plakativer popartiger Expression, volkstümlicher Vereinfachung der opulenten Formen sowie das Spiel mit schwindelerregender Perspektive, die stets wie eine monströse Vergrößerungslinse funktioniert. Im Blickpunkt Jablonskas Werke auf Papier, die sie selbst als „im Dunkeln“ bezeichnet, stehen in quälender Zeitlupe Motive der Gewalt, des sexuellen Begehrens, Rivalität und erotische Intimität, also Sujets, welche die vorangegangene Malergeneration vermieden hat, bzw. nicht in solcher drastischen, irritierenden, subjektiven Formgebung zum Vorschein brachte. Bereits ihre früheren Bilder setzten sich mit diversen kunsthistorischen Modellen von Weiblichkeit (Rousseau, Munch, Gentileschi) auseinander, deren Output Jablonska dem asymmetrischen Gleichgewicht der Geschlechter gemäß in endloser Schleife manchmal humorvoll mit Hinweisen auf Kitsch, Fabeln, Selfies oder andere popkulturelle Bildfindung konterkarierte. Nicht zuletzt noch vor kurzem sind schwarz angezogene Frauen mit schwarzen Regenschirmen in ihrer Heimat mehrmals auf die Straße gegangen, um für ihre Rechte und gegen die Kontrolle über ihre Körper zu protestieren. Öfters werden die Gesichter ihrer Figuren durch Strumpfmasken verdeckt bzw. sind diese kaum sichtbar, dafür aber stechen starr geöffnete Augen oder weit aufgerissene Münde aus der Dunkelheit heraus, die Anonymität der dargestellten Subjekte zugunsten ihrer milieuspezifischen Handlungen betonen. Somit entsteht der Eindruck der subversiven Rebellion gegen jegliche übergeordnete Machtausübung wie auch gegen den männlichen Missbrauch an Frauen insbesondere. Manchmal handelt es sich auch nur um Aspekte ritueller Überlebenskämpfe. Die räumlichen Verzerrungen und befremdlichen Close-ups der Figuren samt der dramatisierten Fragmentierung der Körper und die Platzierung der angefertigten kleineren Blätter in schwarzen Glaskästchen – wie innerhalb von Bildschirmen – markieren die Verschiebung der visuellen Macht von physisch zu digital.
In den aktuellen gezeigten Werken arbeitet Jablonska gewöhnlich mit Schablonen, die sie gekonnt mit einem Spray in differenzierten schwarz-grau Schattierungen und gelegentlich zusätzlich mit der Farbe Rosa bearbeitet. Ihre einprägsamen Images wirken grotesk und poetisch, brutal und zart, konventionell und experimentell in einem. Die Malerin spricht darin die existenziellen Konflikte junger Menschen und ihre zwielichtigen Launen und Zwiespältigkeitan bis hin zu peinlichen Gewaltexzessen, Wutausbrüchen und unerwarteten Spukaktionen. Die fließenden Körper und ihre an die Sinne appellierende glatte Oberflächenerscheinung, die wahrgenommen werden möchte, verdanken sich dem Einfluss der bildlichen Kommunikation in sozialen Medien zwischen Love, Care und Körper-Horror im digitalen Kapitalismus und scheinen eher einem mündlichen als bildimmanenten Charakter zu entsprechen. Demzufolge ist die Ontologie Jablonskas Bildwelten mit dem Überfluss an signalhaften Inhalten und den zirkulierenden Formen, die den schrägen Assoziationen und schmerzhaften Empfindungen lauschen, fluktuierend und flimmernd. Auch die sich daraus ergebenden Bedeutungen sind flüchtig und vorübergehend. Ihre Botschaften alias visuelle Sprache ähneln vielmehr Relationen in digitalen sozialen Netzwerken als bloß behavioristischen Verhaltensmustern im Realen. Und trotz dieses Widerspruchs nehmen wir Jablonskas Visionen wahrer als sie es selbst sind.
In ihren Werken verpflichtet sich die Malerin nicht ausschließlich feministischer Züchtung: die Explosion der (antagonistischen) Emotionen und ihr inneres Feuer richten sich vielmehr gegen jegliche Art der Unterdrückung und Aggression und für das bessere Jetzt. Für ihre Arbeiten auf Papier und collagierte Video-Loops, die aktuell gezeigt werden, eignet sich die Künstlerin als Referenz den Titel eines Popsongs an, den sie einmal im Radio hörte. „No man is big enough for my arms” ist ein Zitat von Suzanne Mallouk, der Partnerin von Jean-Michel Basquiat, das im Lied des französisch-kubanischen, feministischen Zwillings-Duos Ibey mit der Zuversicht an die bessere Zukunft gesungen wird. Trotz der Bewunderung für den Glauben an die ursächliche Kraft einiger ruhmreicher Einstellungen und Absichten (einschließlich künstlerischer), fällt es dennoch schwer, diese im Leben stets zu erfüllen, was, wie Jablonska feststellt, zu Konfrontation, Gewalt, Hate Speech und anderen bitteren Enttäuschungen führt. Über diese emotionellen Spannungen erzählt sie in ihren Werken modifizierend in Anlehnung an die gegenwärtige Selfies Bildtechnik an. Diese gibt ihrer Ausdrucksweise einen neuen Antrieb, der sich im breiten Spektrum an Mimik, Posen und Gestik manifestiert, die, semantisch mit Vorbildern aus der Kunstgeschichte, Pop- und Celebrity-Kultur zu Artefakten verdichtet, gefiltert und gesteigert werden.
Goschka Gawlik
Primary Structures
„What you see is what you see.“
Frank Stella, New Art, 1966
In seinen Arbeiten untersucht Kay Walkowiak häufig die unterschiedlichen kulturellen Herangehensweisen an Kunst, wenngleich er keine Vergleiche ziehen möchte, sondern aufzeigt, dass Konzepte, die in einem Kulturraum Selbstverständlichkeiten sind, außerhalb von diesem gänzlich anders rezipiert werden. In diesem Sinne brachte Walkowiak 2014 Kunstobjekte, die vorrangig im westlich musealen Umfeld präsentiert werden, in eine Kultur mit einer gänzlich anderen ästhetischen Prägung. Er stellte während eines Aufenthalts in Indien Makaken minimalistisch bemalten Platten zur Verfügung. Die Reaktionen der Tiere auf die Werke wurden in „Stimuli“ (Full HD video | 16:9 | 2.22 min. | Color | Sound) filmisch festgehalten. Humorvoll wird damit die Wahrnehmung von Minimalismus und das Betrachten sowie Interpretieren von Kunst hinterfragt. Unter herkömmlichen Umständen wird eine distanzierte, rationale und analytische Betrachtung gefordert – ganz entgegen dem zum Teil affektgeladenen Verhalten der Affen zu den Objekten, fernab von jeglichem intellektuellen Reflektieren.
Eine Vielzahl an potenziellen Rezipienten fühlt sich durch die oftmals komplizierte wissenschaftliche Interpretation von Kunst abgeschreckt und scheut daher die Auseinandersetzung mit zeitgenössischer Kunst. Walkowiak führt allerdings vor Augen, dass die Kunstwerke diese schwerfällige Interpretation nicht zwingend einfordern und ad absurdum geführt werden kann. Der Konstruktivismus der Moderne, Formalismus und Minimal Art kennzeichnen sich unter anderem durch geometrische Gestaltung ohne Bedeutungsebenen. Trotzdem ermutigten die Formen den Betrachter metaphysische Ebenen zu generieren. Die Form wurde als Ausdruck des Intellekts genutzt, um das Vereinfachen im Nachhinein wieder mit Bedeutung zu versehen. Walkowiaks Kritik setzt an diesem Punkt ein. Daher entwirft er Kunstobjekte, die nichts außer sich selbst repräsentieren.
Diesem Gedanken folgend verwendet er in seinen Kunstwerken gerne geometrische Elemente, weil die Form lediglich ein Prinzip ist, allerdings keinerlei Bedeutung transportiert. Trotzdem ist der Betrachter in Versuchung Inhalte in die Geometrie zu projizieren. Diesen Aspekt des konstanten Verlangens Bedeutung zu suchen legt Walkowiak schonungslos offen.
Hierauf basieret die serielle Arbeit „Primary Structures“ (Archival pigment print on Fine Art Photo Rag). Das Performative in „Stimuli“ wurde durch Schwarz-Weiß-Fotografien dokumentiert. Die Kompositionen sind mehrteilige Kunstwerke mit regulierten Abwandlungen. In einer akademischen Bildbetrachtung würde sich die geometrische Form des Quadrats regelrecht quälen lassen. Ein quadratisches Bildfeld ist gleichmäßig unterteilt: Zwei farbige Flächen und eine Fotografie sowie ein ungefülltes Quadrat gliedern jedes Werk. Diese Teile sind konstant, werden lediglich durch die Veränderung der Anordnung akzentuiert. Jedes Quadrat in den einzelnen Arbeiten kann autonom betrachtet werden. Aus kunsttheoretischer Sicht stellt sich die Frage, ob und wie die farbigen Flächen erlebt werden sollen – als räumliches Konstrukt? Dies gelingt zumeist durch die Kontrastwirkung von Farben, deren Dynamik vielleicht sogar Emotionen erzeugen. Allerdings können durch die Anordnung der hier auftretenden Farbflächen keine Tiefe oder sogar Raum erzeugt werden. Wohl ganz im Sinne des Künstlers misslingt die Suche nach einer Metaebene der Farbkompositionen. Die drei bedruckten Quadrate sind in ihrer Zahl eine Reflexion auf die dreigeteilten Platten mit denen die Makaken auf den Fotografien hantieren. Das fehlende vierte Bildelement emanzipiert sich aus dem Gefüge der anderen Flächen und nimmt als Negativform einen Gestaltungscharakter ein; Es ist sowohl ein quadratisches Loch in der Komposition, als auch eine quadratische Fläche.
Alle Einzelarbeiten in „Primary Structures“ bilden einen vollständigen Gedanken. Die Serie wird vom Betrachter wie eine Erzählung gelesen – das performative Moment dringt hierbei erneut durch. Die farbigen Flächen stehen mit den Schwarz-Weiß-Fotografien in formaler Beziehung: Der Affe ist der Rezipient des Kunstobjekte in der Fotografie. Der Betrachter von „Primary Structures“ selbst, kann diesen Moment zusammen mit den farbigen Flächen wahrnehmen, die ihn – ebenso wie die Tiere – zum Konsumenten dieser gegenstandslosen Werke werden lassen und gezwungenermaßen seine derzeit stattfindende Handlung hinterfragt.
Lucia Klee-Beck